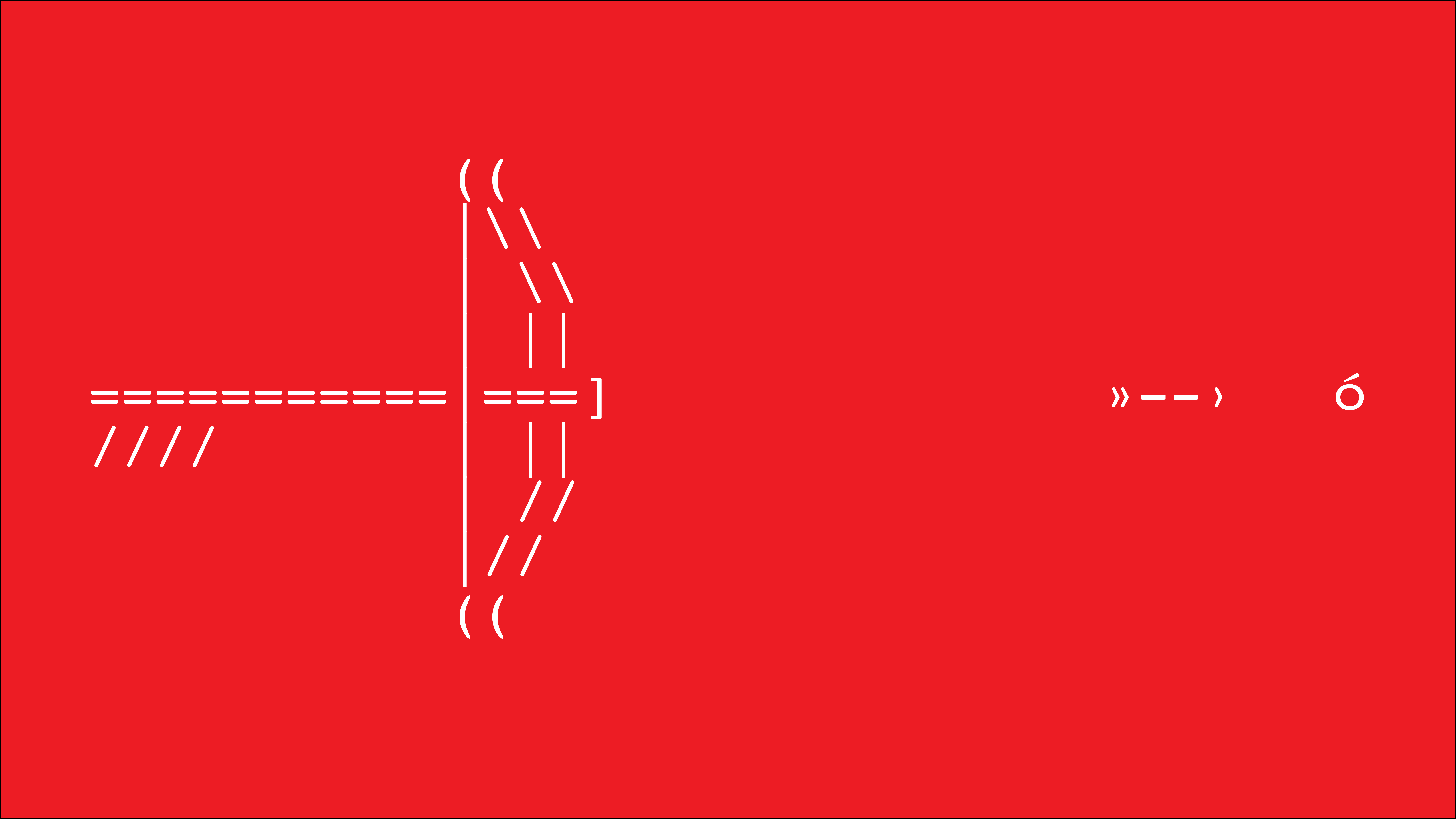Steckt häufiger drin als man denkt: Software made in Switzerland
Interview mit Christian Walter, Geschäftsführer von swiss made software
von Michel Meliopoulos
Input not recognised
Kaum eine Organisation kann ihren Entwicklungsbedarf im digitalen Bereich allein bewältigen. Doch die Vorstellung, immer mehr Glieder der Wertschöpfungskette aus der Hand zu geben – und damit auch Differenzierungsmöglichkeiten –, weckt aus markenstrategischer Sicht ein gewisses Unbehagen. In welchem Mass eine Marke durch Outsourcing im Digitalbereich an Kontrolle und Profilschärfe einbüsst, hängt allerdings wesentlich von der Wahl der ICT-Zulieferer und -Entwicklungspartner ab.
Deutlich negative Handelsbilanz in der ICT
Wie deckt die Schweizer Wirtschaft ihren ICT-Bedarf ab? Im Jahr 2017 hat sie ICT-Dienstleistungen und -Waren im Umfang von 28.1 Mrd. CHF aus dem Ausland bezogen – knapp dreimal so viel wie aus dem Inland. Eine substanzielle Rolle spielt dabei Standardsoftware aus den USA, häufig von Anbietern, die aufgrund ihrer Grösse über beträchtliche Skalen- und Netzwerkvorteile verfügen. Die internationalen ICT-Firmen können vieles bieten, insbesondere tiefe Preise, aber selten eine kollaborative Entwicklungsbeziehung, durch die ihre Geschäftskunden nachhaltige Differenzierung aufbauen können. Nähe und Kleinheit, das sind Trümpfe, welche die Schweizer ICT-Industrie in der Hand hält – doch keineswegs die einzigen.
Qualitäten der Schweizer Software-Industrie ins Bewusstsein bringen
Um bei Produzenten, Auftraggebern wie Anwendern ein stärkeres Bewusstsein für die besonderen Qualitäten der Schweizer Softwareindustrie zu schaffen, hat der ETH-Absolvent und Unternehmer Luc Haldimann 2007 das Label swiss made software gegründet. Diese Woche lanciert das Team hinter swiss made software ein zweites Label: swiss hosting. Zu diesem Anlass haben wir mit dem Geschäftsführer Christian Walter gesprochen – über die Rolle von Herkunfseffekten in der ICT sowie über die spezifischen Erfolgsfaktoren und Herausforderungen des ICT-Standorts Schweiz.

Christian Walter, Geschäftsführer von swiss made software
Christian, bei unserer ersten Begegnung hast Du mir eine Anekdote darüber erzählt, wie Du die Schweiz erlebt hast, als Du 1998 fürs Studium von Deutschland nach Basel gezogen bist. Kannst Du diese nochmals zum Besten geben?
Sicher! Obwohl ich in einer Zeit aufgewachsen bin, in der «Made in Germany» noch präsenter war als heute, war ich am Anfang doch sehr überrascht über die Dominanz des Schweizerkreuzes im Schweizer Alltag. In Deutschland hat man ja ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Verwendung nationaler Symbole…
…ausser während der Fussball-WM…
Richtig! Jedenfalls schien es einem damaligen Kommilitonen aus Deutschland ähnlich zu gehen, als er mich halb im Scherz fragte: «Ist die Schweiz eigentlich ein Land oder eine Marke?» Natürlich ist sie beides.
Hat sich Dein Blick auf die Marke Schweiz in der Zwischenzeit verändert?
Ja, klar, wobei mein anfänglicher Eindruck gar kein negativer war. Es war einfach ungewohnt. Inzwischen sehe ich natürlich viel klarer, wo das alles herkommt. Und als Geschäftsführer des Labels «swiss made software» bin ich schon seit Längerem selbst zu einem Treiber dieser Markenkultur geworden.
Es wird häufig behauptet, dass Herkunftseffekte im Zeitalter der globalen Arbeitsteilung an Bedeutung verlieren, insbesondere in den jüngeren Wirtschaftszweigen. Wie steht man bei swiss made software zu dieser Sichtweise?
Es gibt mehrere Gründe, aus denen wir dieser Sichtweise skeptisch gegenüberstehen.
Erstens haben wir gerade in der ICT das Paradebeispiel für das Gegenteil. Das Silicon Valley hat so viel Strahlkraft, dass es für andere ICT-Standorte schwierig ist, überhaupt als solche wahrgenommen zu werden.
Zweitens glaube ich, dass der Nationalstaat wieder an Bedeutung gewinnt, weil es in Folge der globalen Finanzkrise 2008 vielerorts zu einem Vertrauensbruch mit der Idee einer vollständig globalisierten Wirtschaft gekommen ist.
Drittens spricht die Entwicklung unserer Mitgliederzahl klar gegen die Ansicht, dass Herkunftsmarken im ICT-Bereich nichts zählen. 2011 hatten wir etwa 150 Label-Träger, heute sind es über 700. Unser Wachstum reflektiert dabei die Entwicklung der Schweizer ICT-Branche. Es muss handfeste wirtschaftliche Gründe geben, wenn so viele Unternehmen in einen Produktionsstandort mit vergleichsweise hohen Lohnkosten investieren.
Die Schweizer ICT-Landschaft ist stark von KMU geprägt, in denen man sich als Vertreter der Schweizer Ingenieurstradition versteht.
Wie ist es eigentlich zur Entstehung von swiss made software gekommen?
Das Label swiss made software wurde vor etwas mehr als zehn Jahren von Luc Haldimann lanciert, ursprünglich als kleines Nebenprojekt. Luc Haldimann war bereits in den 90er-Jahren sehr erfolgreich als IT-Unternehmer unterwegs, auch international. Im Ausland hat er dabei häufig erlebt, dass Geschäftspartner erstaunt reagierten, wenn sie erfuhren, dass sein Unternehmen aus der Schweiz stammt, so à la: «Was? In der Schweiz gibt es noch etwas anderes als Uhren, Schokolade, Käse und Banken?» Luc erkannte damals, dass die Sichtbarkeit der Schweizer ICT-Branche gesteigert werden muss. Auch heute besteht in dieser Hinsicht immer noch viel Handlungsbedarf. Umgekehrt besteht vonseiten der einheimischen ICT-KMU offenbar ein grosses Interesse daran, die eigene Herkunft glaubwürdig auszuloben. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass die verbreitete Vorstellung, man habe es bei der ICT-Branche mit einem Haufen «digitaler Nomaden» ohne lokalen Bezug zu tun, nicht den Realitäten in der Schweiz entspricht. Die Schweizer ICT-Landschaft ist stark von KMU geprägt, in denen man sich als Vertreter der Schweizer Ingenieurstradition versteht. Die Schweizer ICT-Unternehmen sind im Durchschnitt deutlich Swissness-affiner als zum Beispiel die Schweizer Pharmaunternehmen, in denen man Englisch spricht und versucht, internationales Flair auszustrahlen.
Welchen Nutzen bringt das Label «swiss made software» Euren Mitgliedern?
Natürlich kommt man mit der Aussage: «Wir sind aus der Schweiz, also zahlt uns mehr!», meistens nicht allzu weit, wobei es in Asien durchaus vorkommen kann, dank des Schweizer Kreuzes eine erhöhte Zahlungsbereitschaft zu finden. Das Ausloben der Schweizer Herkunft hilft aber dabei, Vertrauen in die abgegebenen Leistungsversprechen aufzubauen. Das Schweizer Understatement zahlt sich hier aus, und zwar in der Form von erhöhter Glaubwürdigkeit. Zum Vergleich: Im Silicon Valley werden zweifellos grossartige Dinge entwickelt. Aber es ist bei Weitem nicht alles real, was die dort ansässigen Unternehmen ihren Kunden und Aktionären verkaufen. Innerhalb der Schweiz spielt neben der erhöhten Glaubwürdigkeit auch noch ein weiterer Faktor eine Rolle: Viele Schweizer KMU ausserhalb der ICT-Branche sowie öffentlich finanzierte Organisationen bevorzugen es, einheimische ICT-Anbieter zu beauftragen.
Ihr verwaltet inzwischen ja nicht nur ein Swissness-Label, sondern deren zwei. Wie unterscheiden sich die beiden voneinander?
Bei «swiss made software» geht es, wie auch bei den 2017 inkraftgetretenen Swissness-Regeln um den Schweizer Wertanteil von Produkten. Wir haben bereits vor 2010 ein Minimum von 60% umgesetzt. Beim jüngeren Label «swiss hosting» geht es darum, wo die Server stehen, auf denen bestimmte Daten gespeichert sind oder bestimmte Programme laufen. Die Lancierung des zweiten Labels war eine Reaktion auf die Einsicht, dass die Schweiz sowohl hinsichtlich des regulatorischen Umfelds sowie hinsichtlich ihrer Reputation als stabiler, vertrauenswürdiger und unabhängiger Standort mit seiner weitherum verankerten Rolle als «Safekeeper» sehr attraktive Voraussetzungen für Datenserver und Cloud-Dienstleistungen bietet. Auch das muss man im Kontext des internationalen Markts sehen: Amazon, der weltweit führende Cloud-Services-Anbieter, hat null Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, Daten vor dem Zugriff der amerikanischen Behörden zu schützen. Nicht zuletzt deshalb, weil Amazon auch die CIA-Cloud hostet. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum «swiss hosting» Sinn macht.
Wird die Bedeutung der Schweizer ICT-Branche unterschätzt?
Absolut. Aus meiner Sicht sind im Wesentlichen zwei Ursachen dafür verantwortlich.
Es weiss kaum jemand, dass die Core-Libraries von Android in Winterthur von einer Schweizer Firma im Auftrag von Google entwickelt wurden.
Die erste Ursache besteht darin, dass die einheimische ICT-Industrie sehr B2B-lastig ist und viele Endnutzer sich kaum je bewusst sind, dass sie es mit Produkten oder Dienstleistungen zu tun haben, die von Schweizer ICT-Unternehmen entwickelt worden sind. Viele traditionelle Schweizer Unternehmen verwenden einheimisch entwickelte White-Label-Software, aber davon bekommt kaum jemand etwas mit. In der Schweiz gibt es mehr Unternehmen, die ERP-Software entwickeln als in ganz Deutschland, aber auch davon bekommt man als Endkonsument kaum etwas mit. Es weiss auch kaum jemand, dass die Core-Libraries von Android in Winterthur von einer Schweizer Firma im Auftrag von Google entwickelt wurden.
Die zweite Ursache besteht darin, dass die meisten einheimischen Politiker ein mangelhaftes Verständnis der ICT-Branche und ihrer Bedeutung haben. In dieser Hinsicht hinkt die Politik in der Schweiz und in Europa im Allgemeinen den Amerikanern und Chinesen weit hinterher. Aus meiner Sicht ist das nur schwer nachzuvollziehen, denn es bestreitet ja kaum jemand, dass es sich hier um eine Zukunftsindustrie handelt. Die ICT-Branche gehört zu den wenigen Bereichen, in denen derzeit noch substanzielle Margen erzielt werden.
Wo siehst Du die dringlichsten Herausforderungen für den ICT-Standort Schweiz?
In gewissen Hinsichten ist die Schweiz bereits ein attraktiver Standort für ICT-Unternehmen. Das sieht man nicht zuletzt daran, dass Firmen wie Google oder IBM wichtige Niederlassungen hier haben. Die Schweiz bildet hervorragende IT-Kräfte aus und ist sehr attraktiv für Talente aus dem Ausland. Dennoch leidet die Branche nach wie vor an Fachkräftemangel. Auch die Corona-Krise wird daran nichts ändern.
Die zweite grosse Herausforderung besteht darin, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung für die Wichtigkeit der ICT-Industrie zu sensibilisieren. Etwas zugespitzt formuliert kann man sagen, dass genau diejenigen Länder eine starke ICT-Industrie haben, die wirklich eine haben wollen.
Inwiefern ist die Entwicklung einer starken ICT-Industrie eine Frage des politischen Willens?
Der Blick in die internationale Wirtschaftsgeschichte zeigt ganz klar, dass es nicht einfach eine Frage der freispielenden Marktdynamik ist, ob sich an einem bestimmten Standort eine starke ICT-Industrie entwickelt, sondern zu grossen Teilen eine direkte Konsequenz politischer Entscheidungen. Silicon Valley ist im Wesentlichen eine Reaktion auf den Sputnik-Schock. Der amerikanische Staat hat über die NASA und zahlreiche Rüstungsprojekte unvorstellbare Geldsummen in die Entwicklung der einheimischen ICT-Industrie investiert. Das Internet selbst ist ein Spin-off des vom US-Verteidigungsministerium entwickelten ARPA-Nets. Auch bei anderen führenden ICT-Standorten gaben jeweils politische Entscheidungen den entscheidenden Ausschlag für Entwicklungsschübe. In China sowieso, wegen der Planwirtschaft. Die High-Tech-Affinität von Südkorea ist mitunter darauf zurückzuführen, dass das Land im kalten Krieg durch Investitionen des Westens gezielt zu einem «Bollwerk gegen den Kommunismus» ausgebaut wurde. Ob die Initiative von staatlichen oder von privaten Akteuren kommt, spielt letztlich keine so grosse Rolle. Alfred Escher musste damals auch auf der gesamten Klaviatur spielen, als er die entscheidenden Impulse für den Aufbau des Schweizer Eisenbahnnetzes gab – und daran angehängt, der ETH sowie des Banken- und Versicherungswesens. Worauf es ankommt, ist die grundsätzliche Erkenntnis, dass es einen neuen Entwicklungsschub geben muss, wenn man nicht den Anschluss verlieren will.
Worin siehst Du die spezifischen Erfolgsfaktoren und Chancen des ICT-Standorts Schweiz?
Einen Erfolgsfaktor habe ich schon genannt: Wenn es um die Verwaltung und den Schutz elektronischer Daten geht, haben Anbieter aus der Schweiz einen Vertrauensvorsprung gegenüber US-amerikanischen Anbietern.
Die «Flegeljahre», in denen Google-Entwickler einen Tag oder Nachmittag pro Woche für ihre eigenen Ideen investieren durften, sind vorbei.
Auch in Sachen «employer branding» ist der ICT-Standort Schweiz in einer guten Ausgangslage. Dank der hohen Lebensqualität in der Schweiz können die hier ansässigen ICT-Unternehmen gut ausgebildete Fachkräfte anziehen und langfristig halten. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass GAFA als Arbeitgeber heute bei Weitem nicht mehr so cool sind wie noch vor zehn Jahren. Die «Flegeljahre», in denen Google-Entwickler einen Tag oder Nachmittag pro Woche für ihre eigenen Ideen investieren durften, sind vorbei. Die Tech-Giganten werden immer mehr zu konventionellen Konzernen und konzentrieren sich vermehrt darauf, ihre Marktmacht zu konsolidieren. Hinzu kommt, dass sie immer wieder Negativschlagzeilen provozieren, sei es wegen der Datenschutzproblematik, Fake News oder frauenfeindlichen Arbeitsumgebungen.
Eine weitere Chance des Standorts Schweiz, die noch lange nicht vollständig ausgeschöpft ist, ist der attraktive B2B-Markt: In der Schweiz sind überproportional viele Grossunternehmen angesiedelt, die bei ihrer digitalen Transformation auf starke lokale Partner angewiesen sind. Das konnte man schon in der Vergangenheit beobachten: Die Schweizer ICT-Landschaft ist stark von den Bedürfnissen der Finanzbranche geprägt. Eine Diversifizierung wäre allerdings wünschenswert. Potenzial sehe ich vor allem im Pharma- und Gesundheitsbereich.
Wäre die Schweizer ICT-Industrie damit nicht optimal aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation nicht nur als Effizienztreiber zu nutzen, sondern vermehrt auch als Differenzierungstreiber?
Das ist eine gute Frage. Aus Umfragen wissen wir, dass Kosteneinsparung tatsächlich das dominante Motiv für die meisten Digitalisierungsprojekte ist, welche bei unseren Mitgliedern in Auftrag gegeben werden. Aus Sicht der ICT-Dienstleisterin kann man natürlich immer argumentieren, dass durch die Automatisierung von Prozessen Ressourcen freigesetzt werden, welche der Kunde dann darin investieren kann, sein Leistungspaket stärker zu differenzieren. Ob der Kunde das dann auch tatsächlich tut, interessiert die ICT-Dienstleisterin nicht unbedingt – es sei denn, sie hat gerade die passenden Produkte in ihrem Portfolio. Grundsätzlich wäre die Schweizer ICT-Branche aber gut aufgestellt, um als Differenzierungstreiber für Unternehmen anderer Branchen in Erscheinung zu treten, denn es gibt in der Schweiz viele Individualsoftware-Entwickler und Anbieter von Nischen-Produkten.
Wer sich das «So-und-so-Valley» nennt, präsentiert sich schon einmal als Abklatsch des Originals.
Wie muss man sich denn als Schweizer ICT-Unternehmen positionieren, um im Umfeld der internationalen Tech-Giganten bestehen zu können?
Angesichts der gewaltigen Marktmacht der Tech-Giganten macht es sicher Sinn, eine Nischen-Strategie zu verfolgen. Ob man sich auf eine Nische konzentriert oder nicht – man sollte grundsätzlich versuchen, eigene Wege zu gehen und sich nicht immer GAFA zum Vorbild zu nehmen. Das beginnt bei der Namensgebung: Wer sich das «So-und-so-Valley» nennt, präsentiert sich schon einmal als Abklatsch des Originals. Abgrenzung braucht es aber auch in substanzielleren Aspekten – etwa beim Geschäftsmodell. Das Modell der Daten-Monetarisierung über Eigen- oder Drittwerbung ist womöglich nicht der Weisheit letzter Schluss. Es funktioniert nur, solange die Konsumenten dazu bereit sind, den Unternehmen gratis ihre persönlichen Daten zu überlassen. Sollte sich die Politik entschliessen den Datenschutz strenger zu regulieren, kann sich die Marktsituation von Google oder Facebook sehr schnell ändern. Oder sei es nur, weil auch GAFA jetzt anfangen muss Steuern zu zahlen. Ich empfehle dazu das Stichwort «Datendividende» zu googlen. Die von uns herausgegebenen Labels helfen einheimischen ICT-Unternehmen jedenfalls, sich glaubwürdig abzuheben.
Über swiss made software
Das Label swiss made software wurde 2007 gegründet, um bei Produzenten, Auftraggebern und Anwendern das Bewusstsein für Schweizer Werte in der Softwareentwicklung zu fördern: Qualität, Zuverlässigkeit, Präzision, Offenheit, Innovativität und Flexibilität. Seit der Gründung haben sich über 700 Unternehmen dem Label angeschlossen, die sich als Teil der Schweizer Ingenieurstradition verstehen und sich zum Softwarewerkplatz Schweiz bekennen. Um ein Angebot mit dem Label auszuzeichnen, muss dessen Schweizer Wertanteil mindestens 60 Prozent betragen und der wichtigste Fabrikationsprozess muss in der Schweiz stattgefunden haben.
Damit Dienstleistungen mit dem neu lancierten Label swiss hosting ausgezeichnet werden dürfen, muss das Hosting der angebotenen Applikationen, sowie aller Personendaten und Sachdaten (Geschäftsinformationen, Finanzdaten, – Forschungsergebnisse, etc.) in einem Rechenzentrum in der Schweiz stattfinden. Datenschutz und Datensicherheit müssen schweizerischem Recht unterstehen. Auch der Geschäftssitz des Anbieters muss sich in der Schweiz befinden.
Über den Schweizer ICT-Sektor
Die Zahl der ICT-Beschäftigten in der Schweiz wächst derzeit zweieinhalbmal so schnell wie die Gesamtzahl der Beschäftigten. Im Jahr 2019 arbeiteten 242’600 Personen als ICT-Fachkräfte in der Schweiz, ein Drittel davon in der ICT-Kernbranche. Damit ist die ICT das siebtgrösste Berufsfeld in der Schweiz, vergleichbar mit dem Gastgewerbe und dem Bildungssektor. 2017 erzielte die ICT-Branche eine Bruttowertschöpfung von CHF 30.4 Mrd., also gut halb so viel wie der Finanzsektor. Exporte sind für knapp zwei Drittel der Schweizer ICT-Wertschöpfung verantwortlich. Dennoch weist die Schweiz im ICT-Bereich eine deutlich negative Handelsbilanz auf: Dem Exportvolumen von CHF 19.5 Mrd. stand 2017 ein Importvolumen von CHF 28.1 Mrd. gegenüber. Der grösste Importüberschuss existiert im Handel mit den USA, der grösste Exportüberschuss im Handel mit Deutschland.
Druckerfreundliche VersionDownload
|
swiss made softwareExterner Link
|
Swissness-NutzungProduktseite
|
Standort-EntwicklungProduktseite
|
Copyright © Swiss Brand Experts AG. Alle Rechte vorbehalten.